Marcuphen v. Ct Tabletten
Abbildung ähnlich
Zuzahlung
Zuzahlung
7
Leider führen wir diesen Artikel nicht
50 St
Leider führen wir diesen Artikel nicht
Packungsgröße: 50 St
Außer Handel
- PZN
- 07636014
- Darreichung
- Tabletten
- Hersteller
- AbZ-Pharma GmbH (D)
Produktdetails & Pflichtangaben
verschreibungspflichtiges Arzneimittel
Indikation
- Das Präparat ist ein Mittel zur Hemmung der Blutgerinnung (Antikoagulans).
- Das Arzneimittel wird angewendet zur:
- Behandlung und Vorbeugung arterieller und venöser Thrombosen (Gefäßverschlüsse) und Embolien (Verschlüsse von Gefäßen durch ein Blutgerinnsel).
- Langzeitbehandlung des Herzinfarktes, wenn ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Komplikationen (Gefäßverschlüsse) gegeben ist.
- Hinweise:
- Bei der Anwendung zur Vorbeugung eines erneuten Herzinfarktes (Reinfarktprophylaxe) nach Entlassung aus dem Krankenhaus (Posthospitalphase) ist der Nutzen einer Langzeitgerinnungshemmung (Langzeitantikoagulation) besonders sorgfältig gegen das Blutungsrisiko abzuwägen.
- Die gerinnungshemmende Wirkung des Präparates setzt mit einer Verzögerung (Latenz) von ca. 36 bis 72 Stunden ein. Falls eine rasche Gerinnungshemmung (Antikoagulation) erforderlich ist, muss die Behandlung mit Heparin eingeleitet werden.
Gegenanzeigen
- Das Arzneimittel darf nicht eingenommen werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Phenprocoumon oder einen der sonstigen Bestandteile des Präparates sind.
- bei Erkrankungen, die mit einer erhöhten Blutungsbereitschaft einhergehen, z. B. krankhafter Blutungsneigung (hämorrhagische Diathesen), schwerer Lebererkrankung (Leberparenchymerkrankungen), stark eingeschränkter Nierenfunktion (manifeste Niereninsuffizienz), schwerem Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie)
- bei Erkrankungen, bei denen der Verdacht auf eine Läsion des Gefäßsystems besteht, z. B.:
- plötzlich auftretender Schlaganfall (apoplektischer Insult)
- akute Entzündung der Herzinnenhaut (floride Endocarditis lenta)
- Entzündung des Herzbeutels (Perikarditis)
- Ausweitung eines arteriellen Blutgefäßes innerhalb des Gehirns (Hirnarterienaneurysma
- besondere Form der Ausweitung der Hauptschlagader (disseziierendes Aortenaneurysma)
- Geschwüre (Ulzera) im Magen-Darm-Bereich
- Operation am Auge
- Netzhauterkrankungen (Retinopathien) mit Blutungsrisiko
- Verletzungen (Traumen) oder chirurgische Eingriffe am Zentralnervensystem
- fortgeschrittene Gefäßverkalkung (Arteriosklerose)
- bei fixiertem und nicht auf eine Behandlung ansprechenden (behandlungsrefraktärem) Bluthochdruck (Hypertonie) mit Werten über 200/105 mmHg
- bei Lungenschwindsucht mit Hohlraumbildung (kavernöser Lungentuberkulose)
- nach Operationen am Harntrakt (urologischen Operationen solange Blutungsneigung [Makrohämaturie] besteht)
- bei ausgedehnten offenen Wunden (auch nach chirurgischen Eingriffen)
- bei drohender Fehlgeburt (Abortus imminens)
- in der Schwangerschaft (Ausnahme: absolute Indikation zur Gerinnungshemmung [Antikoagulation] bei lebensbedrohlicher Heparin-Unverträglichkeit).
Dosierung
- Nehmen Sie das Präparat immer genau nach der Anweisung des Arztes ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.
- Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
- Die Dosierung des Präparates muss durch die Bestimmung der Thromboplastinzeit vom Arzt überwacht und individuell angepasst werden. Das Messergebnis dieser Bestimmung wird als INR (International Normalized Ratio) angegeben.
- Die erste Bestimmung sollte stets als Gesamtgerinnungsbestimmung zum Ausschluss okkulter Gerinnungsstörungen (PTT, Thrombinzeit, Heparin-Toleranztest) vor Beginn der Behandlung mit dem Präparat erfolgen. Angestrebt wird ein wirksamer Bereich, je nach Art der vorliegenden Erkrankung, von 2,0 bis 3,5 INR.
- In Abhängigkeit vom Anwendungsgebiet sind folgende INR-Werte
anzustreben:- Indikation
- Postoperative Prophylaxe tiefer venöser Thrombosen
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Längere Immobilisation nach Hüftchirurgie und Operationen von Femurfrakturen
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Therapie tiefer Venenthrombosen, Lungenembolie und TIA
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Rezidivierende tiefe Venenthrombosen, Lungenembolien
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Myokardinfarkt, wenn ein erhöhtes Risiko für thromboembolische Ereignisse gegeben ist
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Vorhofflimmern
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Herzklappenersatz, mechanisch
- INR-Bereich 2,0 bis 3,5
- Herzklappenersatz, biologisch
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Zweiflügelprothesen in Aortenposition
- INR-Bereich 2,0 bis 3,0
- Postoperative Prophylaxe tiefer venöser Thrombosen
- Indikation
- Die Therapie wird üblicherweise mit einer höheren Anfangsdosis eingeleitet.
- Es wird empfohlen, je nach Ausgangswert der Gerinnungsparameter am
- 1. Behandlungstag 2 bis 3 Filmtabletten des Präparates (entsprechend 6 bis 9 mg Phenprocoumon) und am
- 2. Behandlungstag 2 Filmtabletten des Präparates (entsprechend 6 mg Phenprocoumon) zu verabreichen.
- Ab dem 3. Tag muss regelmäßig die Gerinnungszeit bestimmt werden, um den Reaktionstyp des Patienten festzustellen (Hypo-, Normo-, Hyperreaktion).
- Liegt der INR-Wert niedriger als der angestrebte therapeutische Bereich (siehe Tabelle oben), werden täglich 1 ½ Filmtabletten des Präparates (entsprechend 4,5 mg Phenprocoumon) gegeben.
- Liegt der INR-Wert im angestrebten therapeutischen Bereich, wird täglich 1 Filmtablette des Präparates (entsprechend 3 mg Phenprocoumon) gegeben.
- Liegt der INR-Wert höher als der therapeutische Bereich (INR größer als 3,5), wird täglich ½ Filmtablette des Präparates (entsprechend 1,5 mg Phenprocoumon) gegeben.
- Bei INR-Werten größer als 4,5 soll keine Gabe des Präparates erfolgen.
- Die Erhaltungsdosis muss dann - ebenso wie die Initialdosis - dem ermittelten INR-Wert angepasst werden. In der Regel genügen niedrige Erhaltungsdosen von ½ bis 1 ½ Filmtabletten des Präparates (entsprechend 1,5 bis 4,5 mg Phenprocoumon) pro Tag, um den INR-Wert konstant im angestrebten Bereich zu halten.
- Die Gerinnung sollte bei stabil eingestellten Patienten in regelmäßigen Zeitabständen mindestens alle 3 bis 4 Wochen überprüft werden.
- Kinder
- Zur Dosierung bei Kindern unter 14 Jahren liegen keine ausreichenden Erkenntnisse vor.
- Ältere Patienten
- Bei Patienten älter als 60 Jahren, insbesondere bei Frauen dieser Altersgruppe, kann aufgrund der herabgesetzten Ausscheidung (metabolischen Clearance) von Phenprocoumon eine Dosisreduktion notwendig sein, um den angestrebten therapeutischen INR-Bereich nicht zu überschreiten.
- Hinweis:
- Bei Patienten mit verstärkter Neigung zu Hautnekrosen wird eine niedriger dosierte Einleitung der Behandlung empfohlen.
- Dauer der Anwendung
- Über die Anwendungsdauer entscheidet der behandelnde Arzt. Die Dauer der Antikoagulanzienbehandlung sollte nach Möglichkeit schon vor Behandlungsbeginn festgelegt werden. Der Arzt sollte regelmäßig prüfen, ob eine weitere Einnahme des Präparates nötig ist.
- Bei den meisten thrombosegefährdeten Patienten ist eine 3- bis 4-wöchige Prophylaxe mit dem Präparat angezeigt; zumindest sollte die Antikoagulation so lange erfolgen, bis der Patient ausreichend mobil ist. Zu frühes Absetzen vergrößert die Thrombosegefahr. Nach Operationen und Geburten sollte das Präparat vom 2. oder 3. Tag an gegeben werden.
- Bei akuter Thrombose oder schon bestehender Embolie ist die Einleitung der Antikoagulanzientherapie durch intravenöse Applikation von Heparin unerlässlich. Nach Überwindung der akuten Krankheitsphase - d. h. frühestens nach 2, in schweren Fällen nach mehreren Tagen - kann die Behandlung mit dem Präparat weitergeführt werden. Am ersten Übergangstag sollte der Patient neben der unverminderten Menge von Heparin die volle Initialdosis des Präparates erhalten, denn Heparin hat keine Nachwirkung, während das Präparat die bereits erwähnte Latenzzeit bis zum Eintritt des gerinnungshemmenden Effektes aufweist. Während dieser Umstellung ist eine besonders sorgfältige Kontrolle der Gerinnungsverhältnisse notwendig. Die Dauer der Behandlung mit Heparin hängt von der Zeitspanne bis zum Erreichen des erwünschten Grades der Antikoagulation ab. Die Behandlung mit dem Präparat richtet sich nach den klinischen Bedürfnissen; sie kann sich über mehrere Monate, gegebenenfalls Jahre, erstrecken.
- Bei Herzinfarkt werden mit der Langzeitbehandlung (über Monate und Jahre) gute Ergebnisse erzielt. Die Höhe der Dosierung richtet sich auch hier nach dem Ergebnis der Gerinnungskontrolle (INR-Wert).
- Umstellung von Heparin auf das Präparat
- Für den Übergang von Heparin auf das Präparat ergibt sich folgendes Schema:
- Erster Tag der Umstellung
- Das Präparat: 1-mal 2 bis 3 Filmtabletten (entsprechend 6 bis 9 mg Phenprocoumon)
- Heparin: Dauerinfusion (20.000 bis 30.000 I.E. p.d.) oder alle 8 Stunden 7.500 I.E. s.c.
- Zweiter Tag der Umstellung
- Das Präparat: 1-mal 2 Filmtabletten (entsprechend 6 mg Phenprocoumon)
- Heparin: Dauerinfusion (20.000 bis 30.000 I.E. p.d.) oder alle 8 Stunden 7.500 I.E. s.c.
- Dritter Tag der Umstellung und weitere Behandlungszeit
- Das Präparat: Erhaltungsdosis von ½ bis 1 ½ Filmtabletten (entsprechend 1,5 bis 4,5 mg Phenprocoumon) pro Tag je nach INR-Wert (siehe orale Gabe ab dem 3. Tag)
- Heparin: absetzen, wenn das Präparat die volle Wirksamkeit (siehe Tabelle der anzustrebenden INR-Werte) erreicht.
- Erster Tag der Umstellung
- Für den Übergang von Heparin auf das Präparat ergibt sich folgendes Schema:
- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung des Präparates zu stark oder zu schwach ist.
- Wenn Sie eine größere Menge des Präparates eingenommen haben als Sie sollten
- Erkennbare Zeichen einer akuten Überdosierung können, abhängig von deren Ausmaß, sein: Blutbeimengungen im Urin, kleine punktförmige Blutungen an Stellen mechanischer Belastung, spontane Haut- und Schleimhautblutungen, Blutstuhl, Verwirrtheitszustände bis hin zur Bewusstlosigkeit.
- Verständigen Sie bei dem Verdacht auf eine Überdosierung sofort den behandelnden Arzt. Ihr Arzt wird sich bei der Behandlung der Überdosierung am Krankheitsbild orientieren.
- Bewusstlosigkeit kann ein Anzeichen für eine Gehirnblutung sein. Die sofortige notärztliche Behandlung ist erforderlich.
- Therapie
- Spezifischer Antagonist: Vitamin K1.
- Bei leichteren Blutungen genügt zumeist das Absetzen des Antikoagulans.
- Bei behandlungsbedürftigen Blutungen sollten 5 bis 10 mg Vitamin K1 oral verabreicht werden. Nur bei lebensbedrohlichen Blutungen sollten 10 bis 20 mg Vitamin K1 langsam i.v. (Vorsicht: anaphylaktoide Reaktion möglich) gegeben werden. Falls der INRWert nicht sinkt, soll die Applikation nach einigen Stunden wiederholt werden.
- Wenn in Fällen von sehr starker oder bedrohlicher Blutung der Eintritt der vollen Vitamin-K1-Wirkung nicht abgewartet werden kann, ist durch Infusion von virusinaktiviertem Prothrombinkomplexkonzentrat (PPSB) die Aufhebung der Phenprocoumon-Wirkung möglich.
- Durch orale Verabreichung von Colestyramin (fünfmal 4 g/Tag) kann die Ausscheidung von Phenprocoumon zusätzlich beschleunigt werden.
- Eine engmaschige Überwachung der Gerinnungsparameter sollte gewährleistet sein.
- Wenn Sie die Einnahme des Präparates vergessen haben
- Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben. Informieren Sie Ihren Arzt, damit er entscheiden kann, ob eine Bestimmung des INR-Werts erforderlich ist.
- Wenn Sie die Einnahme des Präparates abbrechen
- Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, bevor Sie die Behandlung mit dem Präparat verändern. Wenn Sie die Behandlung mit dem Präparat unterbrechen oder vorzeitig beenden, besteht das Risiko eines Gefäßverschlusses durch Blutgerinnsel.
- Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Nebenwirkungen
- Wie alle Arzneimittel kann das Präparat Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.
- Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:
- Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10
- Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100
- Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000
- Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000
- Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000
- Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
- Mögliche Nebenwirkungen:
- Endokrine Erkrankungen
- Gelegentlich: Blutungen im Bereich der Bauchspeicheldrüse und der Nebenniere
- Erkrankungen des Nervensystems
- Gelegentlich: Blutungen im Bereich des Rückenmarks und Gehirns
- Sehr selten: Kompressionssyndrom des Nervus femoralis infolge einer retroperitonealen Blutung
- Augenerkrankungen
- Gelegentlich: Netzhautblutungen
- Herzerkrankungen
- Gelegentlich: Blutungen im Bereich des Herzbeutels
- Gefäßerkrankungen
- Sehr häufig: Blutergüsse (Hämatome) nach Verletzungen
- Gelegentlich: brennende Schmerzen in den Großzehen mit gleichzeitiger Verfärbung der Großzehen (purple toes)
- Die Antikoagulanzientherapie kann zu einer erhöhten Freisetzung von Material aus atheromatösen Plaques führen und das Risiko für Komplikationen durch systemische Cholesterol-Mikroembolisation einschließlich „purple toes syndrome" erhöhen. Die Beendigung der Falithrom Therapie wird empfohlen, wenn solche Phänomene beobachtet werden.
- Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums
- Sehr häufig: Nasenbluten (Epistaxis)
- Gelegentlich: Blutungen im Bereich der Pleurahöhle
- Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts
- Gelegentlich: Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Durchfall (Diarrhö), Einblutung in die Darmwand (Antikoagulanzienabdomen), Blutungen aus dem Magen-Darm-Trakt
- Leber- und Gallenerkrankungen
- Häufig: Leberentzündungen (Hepatitiden) mit oder ohne Gelbsucht (Ikterus)
- Sehr selten: schwere Lebererkrankungen (Leberparenchymschäden), Leberversagen mit erforderlicher Lebertransplantation oder mit Todesfolge
- Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes
- Sehr häufig: Zahnfleischbluten
- Gelegentlich: Nesselsucht (Urtikaria), Hautausschlag (Exantheme), Juckreiz (Pruritus), entzündliche Hautreaktionen (Dermatitis), vorübergehender Haarausfall (reversible Alopecia diffusa)
- Selten: Punktartige Hautblutungen (Purpura). Hier sollte differentialdiagnostisch eine Verminderung der Blutplättchenmenge (Thrombozytopenie) oder eine allergisch bedingte entzündliche Blutgefäßerkrankung (Vaskulitis) in Erwägung gezogen werden.
- Sehr selten: allergische Hautreaktionen, schwere Hautnekrosen (Absterben von Hautbezirken) mit Todesfolge (Purpura fulminans) oder der Folge einer dauerhaften Behinderung. Ein Zusammenhang mit einer vorbestehenden Erkrankung des Blutgerinnungssystems (Mangel an Protein C oder seines Cofaktors Protein S) sind beschrieben worden. Es scheint, dass Nekrosen von lokalen Thrombosen begleitet sind, deren Auftreten sich einige Tage nach Beginn der Antikoagulanzientherapie zeigt. Besteht der Verdacht, dass derartige Hautveränderungen durch das vorliegende Arzneimittel verursacht sind, muss dieses abgesetzt und (ggf. nach Gabe von Vitamin K1) eine Behandlung mit Heparin erwogen werden. Durch sorgfältige Diagnostik sollten mögliche Grunderkrankungen, die mit Hautnekrosen einhergehen könnten, ausgeschlossen werden.
- Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
- Gelegentlich: Blutungen im Bereich von Gelenken, Muskeln, nach längerer Anwendung (Monate) kann sich - insbesondere bei dazu disponierten Patienten - ein Knochenschwund (Osteopenie/ Osteoporose) entwickeln
- Erkrankungen der Nieren und Harnwege
- Sehr häufig: Blut im Urin (Hämaturie) einschließlich Mikrohämaturie
- Gelegentlich: Blutungen im Bereich des rückseitigen Bauchfells (Retroperitoneums)
- Je nach Ort oder Ausdehnung können auftretende Blutungen im Einzelfall lebensbedrohlich sein oder Schäden hinterlassen, wie z.B. Lähmungen nach einer Nervenschädigung.
- Bei Auftreten von Blutungen oder anderer Anzeichen einer Überdosierung ist sofort der Arzt aufzusuchen.
- Unter Langzeittherapie mit dem Präparat sollten im Rahmen der ärztlichen Überwachung regelmäßige Leberfunktionsprüfungen durchgeführt werden, da in seltenen Fällen Leberparenchymschäden auftreten können.
- Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht angegeben sind.
- Endokrine Erkrankungen
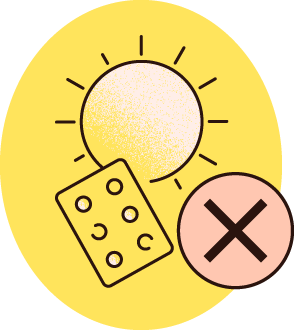
Bitte schützen Sie das Arzneimittel vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.
Bei Fragen lesen Sie bitte die unten stehenden Informationen, wenden Sie sich an Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder kontaktieren uns.
- Besondere Vorsicht bei der Einnahme des Präparates ist erforderlich,
- bei Anfallsleiden (z. B. Epilepsie)
- bei chronischem Alkoholismus
- bei Nierensteinkrankheit (Nephrolithiasis)
- bei Bluthochdruck
- bei Unzuverlässigkeit in der regelmäßigen Einnahme
- in der Stillzeit.
- Ohne Aufhebung (Antagonisierung) der gerinnungshemmenden Wirkung dürfen intramuskuläre Injektionen, Lumbalpunktionen, rückenmarksnahe Regionalanästhesien sowie Angiographien unter der Behandlung mit dem Präparat aufgrund der Gefahr massiver Einblutungen nicht durchgeführt werden. Beim Einspritzen unter die Haut (subkutane Injektion) ist das Risiko von Einblutungen deutlich geringer, Einspritzen in ein Blutgefäß (intravenöse Injektion) kann ohne Bedenken durchgeführt werden. Bei invasiven diagnostischen Eingriffen ist das Nutzen-Risiko-Verhältnis zwischen Blutungsrisiko und Rethrombose abzuwägen.
- Besonders sorgfältige Überwachung der Dosierung ist angezeigt, wenn das Präparat nach Operationen angewendet wird, bei denen eine erhöhte Gefahr sowohl von Blutgerinnselbildung (Thrombosen) als auch von Blutungen besteht (z. B. Entfernung von Teilen der Lunge [Lungenresektion], Operationen der Harn- und Geschlechtsorgane, des Magens und der Gallenwege), ferner bei schwerer Herzerkrankung (Herzdekompensation), Blutgefäßverkalkung (Arteriosklerose), hohem Blutdruck (Hypertonie), leichterer Lebererkrankung (Hepatopathie), entzündlicher Blutgefäßerkrankung (Vaskulitis) sowie schwerer Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).
- Bei bestimmten Nierenerkrankungen (nephrotisches Syndrom) ist die Wirkung des Präparates verringert (vermehrte Ausscheidung des an Plasmaeiweiß [Albumin] gebundenen Wirkstoffes).
- Nach Verletzungen (Traumen), wie z. B. infolge eines Unfalls, besteht erhöhte Blutungsgefahr. Vermeiden Sie daher Tätigkeiten, die leicht zu Unfällen oder Verletzungen führen können.
- Menstruationsblutungen stellen dagegen keine Gegenanzeige für das Präparat dar. Bei außergewöhnlich starken und exzessiv verlängerten Blutungen oder Durchbruchblutungen sollte aber ein Gynäkologe zum Ausschluss einer organischen Verletzung aufgesucht werden.
- Aufgrund vielfacher Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sollten Sie während einer Therapie mit dem Präparat weitere Medikamente grundsätzlich nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt einnehmen oder absetzen. Bei Änderungen der Nebenmedikation durch Hinzufügung oder Absetzen zusätzlich eingenommener Medikamente sollten häufigere Gerinnungskontrollen durchgeführt werden.
- Bei gleichzeitiger Behandlung mit anderen Medikamenten oder bei abrupter Umstellung der Ernährungsgewohnheiten und Einnahme von Vitamin-K-haltigen Präparaten sowie bei zwischenzeitlich auftretenden oder gleichzeitig bestehenden Erkrankungen (z. B. Lebererkrankungen, Herzinsuffizienz) kann es zu einer veränderten Wirksamkeit des Präparates kommen. In diesen Fällen empfiehlt es sich, häufigere Gerinnungskontrollen vorzunehmen.
- Eine Veränderung der Gerinnungsparameter und/oder Blutungen sind bei Patienten gemeldet worden, die Capecitabin zusammen mit Cumarin-Derivaten wie Warfarin oder Phenprocoumon einnahmen. Diese unerwünschten Wirkungen traten innerhalb mehrerer Tage und bis zu mehreren Monaten nach Beginn der Behandlung mit Capecitabin auf, in wenigen Fällen auch innerhalb eines Monats nach Ende der Behandlung mit Capecitabin.
- Phenylbutazon und hiervon abgeleitete Substanzen (bestimmte Schmerz- und Rheumamittel) sollten bei einer Behandlung mit dem Präparat nicht angewendet werden.
- Bei hohem gewohnheitsmäßigen Alkoholkonsum kann die gerinnungshemmende Wirkung des Präparates herabgesetzt sein, doch ist bei Leberschwäche (Leberinsuffizienz) auch eine Verstärkung der gerinnungshemmenden Wirkung möglich.
- Eine regelmäßige Kontrolle der Wirkung des Präparates durch Bestimmung der Thromboplastinzeit ist unerlässlich. Die Gerinnung muss stets vor Behandlungsbeginn und während der Behandlung kontrolliert werden. In den ersten Behandlungstagen sind engmaschige (alle 1-2 Tage) Kontrollen angezeigt. Bei stabil eingestellten Patienten sind größere Intervalle zwischen den Kontrollen im Allgemeinen ausreichend (jedoch mindestens regelmäßig alle 3-4 Wochen), sofern keine abrupten Änderungen hinsichtlich Nebenmedikationen, Ernährungsgewohnheiten oder Allgemeinzustand (z. B. Fieber) vorliegen.
- Unter Langzeittherapie mit dem Präparat sollten im Rahmen der ärztlichen Überwachung regelmäßige Leberfunktionsprüfungen durchgeführt werden, da in sehr seltenen Fällen Leberparenchymschäden
auftreten können. - Ihr Arzt sollte Ihnen einen Ausweis ausstellen, aus dem die Antikoagulanzienbehandlung ersichtlich ist und den Sie immer bei sich tragen sollten. Bitte informieren Sie Ihren Arzt bzw. Zahnarzt, dass Sie mit dem Präparat behandelt werden.
- Nach Absetzen der Therapie dauert es 7-10 Tage oder länger, ehe sich die Gerinnungswerte normalisiert haben.
- Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
- Das Arzneimittel hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.
Schwangerschaft und Stillzeit
- Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.
- Während der Schwangerschaft darf und während der Stillzeit sollte das Präparat nicht eingenommen werden. Es passiert die Plazentaschranke, und somit besteht die Gefahr von Blutungen beim Fötus (fetale Hämorrhagien). In der Schwangerschaft sind teratogene und embryotoxische Effekte beobachtet worden. Außerdem ist die Anwendung während der Schwangerschaft mit dem möglichen Risiko kindlicher Missbildungen behaftet (fetales Warfarin-Syndrom).
- Das Präparat geht in die Muttermilch über, daher ist eine Verstärkung der physiologischen kindlichen Gerinnungsstörung (Hypoprothrombinämie) in Einzelfällen nicht auszuschließen. Deshalb sollten Säuglinge von mit dem Präparat behandelten Müttern Vitamin K1 erhalten.
- Das Eintreten einer Schwangerschaft muss während der Therapie mit dem Präparat und im Zeitraum von 3 Monaten nach Beendigung der Einnahme wegen erhöhten Risikos kindlicher Missbildungen sicher verhütet werden.
Anwendung
- Zur Teilung legt man die Tablette mit der Bruchkerbe nach oben auf eine feste Unterlage. Um die Tablette zu teilen, drückt man mit beiden Daumen gleichzeitig von oben links und rechts auf die Tablette.
Wechselwirkungen
- Bei Einnahme des Präparates mit anderen Arzneimitteln
- Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/ angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.
- Die Wirkungen mancher Arzneimittel können durch gleichzeitige Anwendung anderer Mittel beeinflusst werden. Fragen Sie daher Ihren Arzt, wenn Sie andere Mittel ständig anwenden, bis vor kurzem angewendet haben oder gleichzeitig mit dem hier vorliegenden Arzneimittel anwenden wollen. Dies gilt auch für Arzneimittel, die Ihnen nicht von Ihrem Arzt verschrieben wurden, z. B. frei verkäufliche Arzneimittel oder pflanzliche Arzneimittel wie Schmerz-, Abführ- oder Stärkungsmittel sowie Vitaminpräparate.
- Ihr Arzt kann Ihnen sagen, ob unter diesen Umständen mit Unverträglichkeiten zu rechnen ist oder ob besondere Maßnahmen, wie z. B. eine neue Dosisfestsetzung, erforderlich sind, wenn Sie dieses Arzneimittel anwenden.
- Welche anderen Mittel beeinflussen die Wirkung des Präparates
- Aufgrund vielfacher Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten dürfen Sie während einer Behandlung mit dem Präparat weitere Medikamente grundsätzlich nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt einnehmen oder absetzen. Bei Änderungen der zusätzlich zu dem Präparat eingenommenen Medikamente (Hinzufügen oder Absetzen) sollten häufigere Kontrollen der Gerinnungswerte durchgeführt werden.
- Eine Wirkungsverstärkung des Präparates und erhöhte Blutungsgefahr bestehen bei gleichzeitiger Anwendung von
- Thrombozytenaggregationshemmern (z. B. Acetylsalicylsäure) oder Arzneimitteln, die zu Mukosaschäden im Magen-Darm-Trakt führen, z. B. nichtsteroidale Mittel mit entzündungshemmender Wirkung (Antiphlogistika)
- anderen Antikoagulanzien: unfraktioniertes Heparin, niedermolekulare Heparine, Heparinoide, Hirudine, Hirudoide, orale Thrombininhibitoren, orale Faktor Xa-Inhibitoren
- Allopurinol (Mittel gegen Gicht)
- Antiarrhythmika (Mittel gegen Herzrhythmusstörungen): Amiodaron, Chinidin, Propafenon
- Methoxsalen (Mittel zur Behandlung von Schuppenfl echte und anderen schweren Hauterkrankungen)
- bestimmten Antibiotika (Mittel zur Behandlung von bakteriellen Infektionen): z. B. Chloramphenicol, Tetrazykline, Trimethoprim-Sulfamethoxazol und andere Sulfonamide, Cloxacillin, Makrolide, N-Methylthiotetrazol-Cephalosporine und andere Cephalosporine (Cefazolin, Cefpodoximproxetil, Cefotaxim, Ceftibuten), orale Aminoglykoside
- Disulfiram (Mittel zur Alkoholentwöhnung)
- Fibraten (Mittel gegen Fettstoffwechselstörungen)
- Imidazolderivaten, Triazolderivaten (Mittel zur Behandlung von Pilzerkrankungen)
- Analgetika und/oder Antirheumatika (Schmerz- und Rheumamittel): Leflunomid, Phenylbutazon und Analoga, Piroxicam, selektive Coxibe, Acetylsalicylsäure, Tramadol
- Methyltestosteron und anderen anabolen Steroiden (muskelbildende Substanzen)
- Schilddrüsenhormonen
- Zytostatika (Mittel zur Behandlung von Krebserkrankungen): z. B. Tamoxifen, Capecitabin
- trizyklischen Antidepressiva (Mittel zur Behandlung von Depressionen)
- anderen Substraten der CYP2C9- und CYP3A4-Cytochrome
- Zotepin (Mittel bei seelischen Erkrankungen)
- Fibrinolytika (Mittel zur Aufl ösung von Blutgerinnseln in den Blutgefäßen)
- Die gleichzeitige Einnahme von Paracetamolhaltigen Schmerzmitteln in hohen Dosen über einen längeren Zeitraum sollte vermieden werden, da die Wirkung des Präparates verstärkt werden kann. Bei gelegentlicher Einnahme von 500-1500 mg Paracetamol/ Tag wurde bisher keine Beeinflussung der Wirkung des Präparates beobachtet.
- Bei gleichzeitiger Einnahme oder Anwendung des Präparates und bestimmten Mitteln gegen Schmerzen oder Reizzustände von Arthrosen, den so genannten COX-2-Hemmern (Rofecoxib, Celecoxib, Valdecoxib, Parecoxib) wird die Wirkung des Präparates verstärkt. Die Blutgerinnung muss deshalb von Ihrem Arzt genau überwacht werden.
- Manche HMG-CoA-Reduktase-Hemmer (Mittel bei Fettstoffwechselstörungen, wie z. B. Lovastatin) können die Wirkung des Präparates verstärken. Die klinische Relevanz dieser Wechselwirkung ist unklar.
- Phenytoin (Mittel gegen Krampfanfälle) und verwandte Mittel können zu Beginn der Behandlung vorübergehend die Wirkung des Präparates verstärken. Bei einer Dauerbehandlung beschleunigen sie den Abbau des Präparates (durch Enzyminduktion) und führen so zu einer Abschwächung der Wirkung des Präparates. Das Präparat kann die Wirkung von Phenytoin verstärken.
- Bei gleichzeitiger Anwendung von Tramadol (Schmerzmittel) sowie Coumarin-Derivaten (Klasse von blutgerinnungshemmenden Arzneimitten, zu denen auch Phenprocoumon gehört) ist über erhöhte INR-Werte sowie Hauteinblutungen berichtet worden.
- Bitte sprechen Sie vor gleichzeitiger Anwendung mit Ihrem Arzt.
- Eine Wirkungsabschwächung des Präparates besteht bei gleichzeitiger oder vorheriger Anwendung von:
- Azathioprin (Mittel gegen Autoimmunerkrankungen, Transplantationsabstoßungen)
- Barbituraten (Schlafmitteln)
- Carbamazepin (Mittel gegen Krampfanfälle)
- Colestyramin (Mittel zur Senkung erhöhter Blutfettwerte)
- Digitalis-Herzglykosiden (Mittel bei Herzmuskelschwäche)
- Diuretika (harntreibende Mittel)
- Corticosteroiden (entzündungshemmende Mittel; Mittel zur Behandlung von Überempfindlichkeitsreaktionen)
- Gluthetimid (Aminogluthetimid)
- Rifampicin (Mittel zur Behandlung bakterieller Infektionen)
- Metformin (Mittel zur Behandlung der Zuckerkrankheit)
- Thiouracil (Schilddrüsenmittel)
- 6-Mercaptopurin (Mittel bei Tumoren)
- Vitamin-K-haltigen Präparaten
- Griseofulvin (Mittel bei Pilzinfektionen)
- Johanniskrauthaltigen Präparaten (Mittel zur Behandlung von Verstimmungszuständen)
- Chinolonen wie Ciprofl oxacin
- ß-Lactam-Antibiotika wie Amoxicillin.
- Bei Einnahme des Präparates zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken
- Da die Wirkung des Präparates durch Vitamin K verringert wird, sollten Sie bestimmte Nahrungsmittel wie Sauerkraut, Rot-, Weiß- und Blumenkohl, Broccoli, Spinat, Kalbsleber und Weizenkeime nur in Maßen zu sich nehmen, da sie viel Vitamin K enthalten.
Bitte achten Sie auch bei der Einnahme von Vitamin-Präparaten
darauf, ob und wie viel Vitamin K enthalten ist. - Eine komplexe Wechselwirkung ergibt sich für Alkohol. Akute Aufnahme erhöht die Wirkung oraler gerinnungshemmender Substanzen (Antikoagulanzien), während chronische Aufnahme diese abschwächt. Bei chronischer Aufnahme von Alkohol und einer Leberschwäche (Leberinsuffizienz) kann es jedoch auch zu einer Wirkungsverstärkung kommen.
- Vermeiden Sie den Genuss von Alkohol.
- Da die Wirkung des Präparates durch Vitamin K verringert wird, sollten Sie bestimmte Nahrungsmittel wie Sauerkraut, Rot-, Weiß- und Blumenkohl, Broccoli, Spinat, Kalbsleber und Weizenkeime nur in Maßen zu sich nehmen, da sie viel Vitamin K enthalten.
Rezeptpflichtige Medikamente dürfen nur gegen Vorlage eines Originalrezepts abgegeben werden. Scannen Sie dafür einfach Ihr E-Rezept oder schicken Sie uns Ihr herkömmliches Rezept per Post zu.
Was passiert eigentlich mit meinem Rezept?
Damit Sie einen Einblick in unsere tägliche Arbeit bekommen und sehen können, was alles mit Ihrem Original-Rezept geschieht, haben wir ein Video mit allen relevanten Informationen produziert.