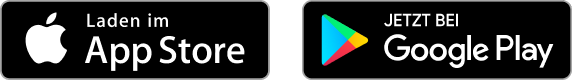Digitale Gesundheitsanwendungen – DiGA

Schnelleinstieg in unsere Themen
Zusammenfassung
Smartphones, Tablets und Co. eröffnen dem Gesundheitssystem neue Möglichkeiten. Bei einigen Erkrankungen gibt es Therapiebegleitungen nun auch digital. Die nötigen Apps für bestimmte Behandlungen können sogar auf Rezept verschrieben werden. Doch wie genau funktionieren die Digitalen Gesundheitsanwendungen, kurz DiGA, und welche gibt es bereits? Was sind ihre Vorteile für die Anwendenden?
Die Digitalisierung hat auch das Gesundheitssystem erfasst und eröffnet neue Wege. Für die alltägliche Gesundheitsförderung haben zahlreiche Hersteller bereits unzählige mobile Anwendungen oder Apps entwickelt. So gibt es unter diesen Apps Schrittzähler, Fitness-Programme, Ernährungshelfer, Entspannungsprogramme und noch vieles mehr. Sie gelten als Gesundheits-Apps oder auch Health-Apps, die jeder nutzen kann, unabhängig davon, ob er oder sie erkrankt ist. Das ist problematisch, denn viele dieser Apps werden zur Unterstützung in der Therapie von Erkrankungen angepriesen, sind jedoch nicht als Therapiemittel zugelassen und bieten keine entsprechende Sicherheit.
DiGA – Gesundheits-Apps mit Zertifikat
Es brauchte ein Regelwerk, um diese Flut an Apps in ihrem medizinischen und therapeutischen Nutzen einzuordnen. Das Digitale Versorgungs-Gesetz (DVG) und die Digitale Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV) regeln seit Dezember 2019 die Versorgung von Patienten mithilfe digitaler Gesundheitsanwendungen (kurz: DiGA). App-Hersteller müssen nun einen Antrag stellen, um ihre Gesundheits-App als DiGA einstufen zu lassen. Hierbei werden verschiedene Anforderungen überprüft, die eine DiGA erfüllen muss, wie zum Beispiel:
- Produktsicherheit und Funktionstauglichkeit
- Datenschutz und Datenverarbeitung
- Informationssicherheit
- Nachweis positiver Versorgungseffekte
Ein wichtiger Aspekt ist, dass eine DiGA als CE-zertifiziertes Medizinprodukt von Ärztinnen und Ärzten auf Rezept verschrieben werden kann und die meisten Krankenkassen anfallende Kosten übernehmen.
DiGA: Bei Erkrankungen digital unterstützt
Insgesamt sind aktuell 56 DiGA vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelistet, mit steigender Tendenz. Es gibt medizinische Gesundheits-Apps für verschiedene Erkrankungsfelder, mit unterschiedlichen Inhalten oder Programmen und unter Berücksichtigung der verschiedenen Altersklassen. So gibt es Apps, die besonders für Jugendliche von 12 bis 17 Jahre, Erwachsene bis 65 Jahren oder ab 65 Jahren geeignet sind. Je nach App erfassen sie Gesundheitsdaten wie zum Beispiel Blutdruck- oder Blutzuckerwerte, auf die die App und das Programm ausgerichtet sind, und werten diese aus. Die einfachsten Anwendungen sind zum Beispiel sogenannte Pill-Reminder oder Medikamenten-Erinnerungs-Apps, die die rechtzeitige Einnahme von Medikamenten durch ein Alarmsignal ankündigen.
Andere Apps unterstützen mit umfangreicheren Programmen zum Beispiel bei der Therapie von
- Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
- Stoffwechselerkrankungen (z. B. bei Diabetes mellitus oder Adipositas),
- Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. bei Rücken- oder Gelenkschmerzen),
- Krebserkrankungen,
- Gehörschäden,
- Erkrankungen des Nervensystems (z. B. bei Migräne oder Schlaganfall),
- und psychischen Erkrankungen
Aufklärung und Therapie im Fokus
Die Wahl beziehungsweise die Entscheidung, welche DiGA bei einer Erkrankung unterstützen kann, obliegt in erster Linie der Ärztin oder dem Arzt. Am häufigsten kommen derzeit Apps bei neurologischen und psychischen Störungen sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Einsatz. Aber auch Menschen mit Diabetes oder Adipositas können von einer digitalen Unterstützung profitieren. Allen digitalen Gesundheitsanwendungen ist gemein, dass sie mit hilfreichen Informationen zur Aufklärung über die jeweilige Erkrankung beitragen und mit Übungsanleitungen eine Therapie auch außerhalb der Praxis ermöglichen und fördern. So kann bei den Patientinnen und Patienten ein umfassenderes Verständnis von Erkrankung und Therapie aufgebaut werden. Sie sind dann meist besser in der Lage, aktiv an ihrer Therapie mitzuarbeiten.
In der Therapie von Schlaganfällen geht es besonders um die Rückführung der Betroffenen in einen selbstbestimmten Alltag. Als Unterstützung in der Behandlung bietet die App neolexon Aphasie Menschen mit Problemen beim Lesen, Sprechen, Schreiben und Verstehen von Worten nach einem Schlaganfall ein logopädisches Training zum täglichen üben als Ergänzung zur Sprachtherapie. Dadurch sollen Nutzende in ihrer Therapie zusätzlich motiviert und positiv bestärkt werden.
Die Auswahl an Apps für Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen, Angst- oder Essstörungen ist deutlich größer. Hierbei kommen häufig mobile Anwendungen in Form einer App in Kombination mit webbasierten Programmen zum Einsatz. Die digitale Anwendung deprexis ist zum Beispiel ein Selbsthilfeprogramm für Personen mit leichten bis schweren depressiven Episoden, das interaktiv und onlinebasiert ist. Es unterstützt die herkömmliche Behandlung in der Psychotherapiepraxis und basiert auf den etablierten Methoden der Verhaltenstherapie.
Rein App-basiert ist der Therapieansatz bei Panikstörungen und Agoraphobie mit Hilfe der App Mindable. Mit ihrer Hilfe können Betroffene beispielsweise Angstzustände live aufzeichnen. Das dient vor allem der Selbstreflexion und hilft, sich an bestimmte körperliche Symptome zu gewöhnen. Die Erfahrungen aus diesen Konfrontationsübungen lassen sich im Nachhinein dann mit der Ärztin oder dem Arzt oder in der Psychotherapiesitzung besprechen. Auch diese App ergänzt im Wesentlichen die eigentliche Verhaltenstherapie beim Therapeuten oder der Therapeutin.
Hilfreiche Tipps und Unterstützung im Therapie-Management gibt es für Menschen mit Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) durch die Apps HelloBetter Diabetes und Depression, glucura Diabetestherapie oder mebix . Sie enthalten unter anderem ein digitales Tagebuch, das in Verbindung mit mobilen Messgeräten wie dem Insulinpen oder einem Blutzuckermessgerät arbeitet. Blutzuckerwerte werden automatisch in die Apps übertragen und ausgewertet. Auf diese Weise haben sowohl der behandelnde Arzt oder die Ärztin als auch die App-Nutzenden selbst den aktuellen Gesundheitszustand im Blick.
Die Apps Zanadio und Oviva Direkt für Adipositas liefern Menschen, die an Fettleibigkeit (Adipositas) erkrankt sind, hilfreiche Informationen zu gesunder Ernährung und geben mit unterschiedlichen Übungen Anreize für mehr Bewegung. Das Ziel ist es, die Gewichtsabnahme nicht nur zu unterstützen und zu erleichtern, sondern auch langfristig zu halten.
Fazit
Einige Menschen fragen sich, welchen Nutzen digitale Gesundheitsanwendungen wirklich haben und ob sie womöglich den Besuch in der ärztlichen oder psychotherapeutischen Praxis in Zukunft ersetzen können. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Nutzung einer DiGA insbesondere die Therapietreue (Adhärenz) der Patientinnen und Patienten verbessern kann. Das bedeutet, dass sie Menschen darin bestärken und motivieren, ihre Therapien bis zum Ende durchzuführen. Nicht selten geben sie sogar Anreiz, das Programm auch nach einer abgeschlossenen Behandlung fortzusetzen, um so den Körper und den Geist gesund und fit zu halten.
Wichtig ist jedoch, dass eine DiGA keine ärztliche Behandlung ersetzen kann. Sie sollten immer in Rücksprache mit dem jeweiligen Arzt oder der Ärztin ausgewählt und angewendet werden. Anwendende sollten darauf achten, dass die medizinische App mit einem CE-Zeichen gekennzeichnet ist, das sie als geprüft und sicher einstuft.
Eine Liste mit allen geprüften und erstattungsfähigen DiGAs gibt es online auf der Seite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfarM).
Veröffentlicht am: 14.03.2022
Letzte Aktualisierung: 09.04.2024
Quellen
[1] Bundesministerium für Gesundheit: Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA): Apps auf Rezept. https://gesund.bund.de/digitale-gesundheitsanwendungen-diga
[2] Bundesministerium für Gesundheit: Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung (DiGAV). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/detail/digitale-gesundheitsanwendungen-verordnung-digav.html
[3] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Das Fast Track Verfahren für digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) nach § 139e SGB V - Ein Leitfaden für Hersteller, Leistungserbringer und Anwender (Stand: 10/2020).
[4] Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: DiGA-Verzeichnis. https://diga.bfarm.de/de/verzeichnis
[5] Verbraucherzentrale: Gesundheits-Apps: medizinische Anwendungen auf Rezept. https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/gesundheitsapps-medizinische-anwendungen-auf-rezept-41241
[6] Krankenkassen Deutschland: Krankenkassen-Apps für Fitness, Gesundheit und Therapie. https://www.krankenkassen.de/gesetzliche-krankenkassen/leistungen-gesetzliche-krankenkassen/apps/
[7] DiGA-Report 2022. Techniker Krankenkasse. https://www.tk.de/resource/blob/2125136/dd3d3dbafcfaef0984dcf8576b1d7713/tk-diga-report-2022-data.pdf