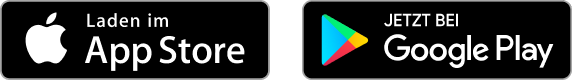Anaphylaktischer Schock – Wenn eine Allergie lebensbedrohlich wird

Schnelleinstieg in unsere Themen
Ein anaphylaktischer Schock entsteht durch eine plötzliche, sehr heftige allergische Reaktion, die sich auf den ganzen Körper auswirkt. Neben den typischen Allergiesymptomen kann es dann zu Herzkreislaufbeschwerden und Atemnot bis hin zu Kreislauf- und Atemstillstand kommen, die unbehandelt tödlich enden - daher handelt es sich um eine Notfallsituation. Die betroffene Person oder Umstehende sollten umgehend den Notarzt verständigen. Die Behandlung richtet sich nach den jeweiligen Symptomen und umfasst unter anderem Medikamente, Infusionen und Sauerstoffzufuhr. Um einen anaphylaktischen Schock zu vermeiden, wird Menschen mit schweren Allergien empfohlen, sich schulen und mit einem Notfallset ausrüsten zu lassen.
Was ist ein anaphylaktischer Schock?
Allergien oder Überempfindlichkeitsreaktionen äußern sich in der Regel dort, wo der erste Kontakt zwischen allergieauslösendem Stoff (Allergen) und dem Immunsystem stattfindet. Bei Heuschnupfen sind das meist die Schleimhäute von Augen, Nase, Mund- und Rachenraum, bei Nahrungsmittelallergien auch Magen und Darm. Meist kommt es zu lästigem Hautausschlag, Schwellungen, Rötungen und Juckreiz, gegebenenfalls auch zu Durchfall und Erbrechen.
Bei einem anaphylaktischen Schock weiten sich diese Effekte der Immunreaktion auf den gesamten Körper aus. Dann kommt es zu plötzlichen, schweren Symptomen wie Kreislaufproblemen, unter Umständen sogar einem Kreislaufversagen und Atemstillstand. Es ist also eine sehr starke, lebensbedrohliche Form der allergischen Reaktion.
Was sind mögliche Symptome eines anaphylaktischen Schocks?
Bei allergischen Reaktionen handelt es sich um eine allergische Sofortreaktion. Das bedeutet, sie folgt meist innerhalb weniger Minuten nach dem Kontakt mit dem allergieauslösenden Stoff. Ein anaphylaktischer Schock geht möglicherweise mit folgenden Symptomen einher:

- Auf Haut und Schleimhäuten: Juckreiz, vor allem an den Hand- und Fußflächen sowie an den Schleimhäuten von Mund- und Rachenraum, teilweise auch im Genitalbereich. Dazu kommen Rötungen, Nesselsucht (Urtikaria), Wassereinlagerungen (Ödeme), möglicherweise auch ein Hitzegefühl. Durch Schwellungen von Zunge oder Kehlkopf können Schluck- und Atembeschwerden entstehen, die im schlimmsten Fall zum Erstickungstod führen können.
- An den unteren Atemwegen: Atemnot durch verengte Bronchien, eventuell ist die Durchlässigkeit der Blutgefäße gesteigert, dadurch lagert sich Wasser in der Lunge an und es kommt zu einem Lungenödem.
- Am Verdauungssystem: Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, unwillkürliches Absetzen von Stuhl oder Urin, bei Frauen eventuell Gebärmutterkrämpfe
- Herz-Kreislaufsystem: Niedriger Blutdruck und beschleunigte Herzfrequenz, teilweise auch Störungen des Herzrhythmus wie ein verlangsamter Herzschlag (Bradykardie). Im Extremfall Schock und Herz-Kreislaufversagen
- Am zentralen Nervensystem: Unruhe, Angstzustände, Kopfschmerzen, Krämpfe oder Bewusstlosigkeit.
Im äußersten Fall können Atemnot durch zugeschwollene Luftwege und Herzkreislaufversagen zum Tod führen.
Wie entsteht ein anaphylaktischer Schock?
Wenn Eiweiße (Proteine) von außen in den Körper gelangen, prüft das Immunsystem, ob sie unter Umständen schädliche Wirkung haben können und bekämpft werden müssen oder ob sie harmlos sind und keine Reaktion erfordern. So werden Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Parasiten, die auf ihren Oberflächen spezifische Proteine tragen, normalerweise eliminiert, Pollen, Hausstaubpartikel und ungefährliche Nahrungseiweiße dagegen nicht.
Das Immunsystem von Personen, die eine Allergie haben, reagiert anders auf eigentlich harmlose Stoffe als das von Menschen, die keine entsprechende Überempfindlichkeit zeigen. In der Folge beginnt es unnötigerweise, diese unschädlichen Proteine zu bekämpfen. Woher diese Fehleinschätzung kommt, ist noch nicht vollständig verstanden.
Nach einem ersten Kontakt mit einem Allergen bildet das Immunsystem von Personen mit einer Allergie innerhalb weniger Tage Antikörper gegen diese Eiweiße aus. Diese Elemente der körpereigenen Abwehr werden als Immunglobuline vom Typ E (IgE) bezeichnet. Normalerweise dienen die IgE der Abwehr von Parasiten, sie können aber auch auf andere Eiweiße reagieren. Es gibt viele verschiedene Versionen der IgE-Antikörper, die so geformt sind, dass sie nur an spezielle Strukturen (Antigene) binden können. Sie wirken deshalb sehr spezifisch auf bestimmte Proteine. So kann eine Version beispielsweise an Pollen gewisser Pflanzen binden, an die anderer Arten, Hausstaub oder Lebensmittel, aber nicht.
Häufige allergieauslösende Stoffe (Allergene) sind beispielsweise
- Insektengifte (z. B. Allergien gegen Bienen- und Wespenstiche),
- Pollen von Pflanzen wie Birken, Haseln oder Gräsern
- Eiweiße aus dem Kot von Hausstaubmilben (Hausstauballergie),
- Lebensmittel wie Äpfel, Nüsse, Meeresfrüchte oder
- bestimmte Medikamente, etwa Antibiotika wie Penicillin.
Kommt es nun zu einem erneuten Kontakt mit dem jeweiligen Allergen, binden die im Körper inzwischen gebildeten Immunglobuline an das jeweilige Antigen und alarmieren in der Folge bestimmte Immunzellen, insbesondere Mastzellen und basophile Granulozyten. Diese setzen daraufhin einen Cocktail unterschiedlicher Signalstoffe frei. Dazu gehören unter anderem Histamin, aber auch Prostaglandine, Leukotriene und Heparin, die als Mediatoren (auf Deutsch: Vermittler) bezeichnet werden. Sie führen beispielsweise zu:
- Einer Erweiterung der Arterien
- Verkrampfung (Spasmus) von Venen und Bronchien
- Einer erhöhten Durchlässigkeit der Gefäßwände, was zu Flüssigkeitsansammlungen im Gewebe führen kann.
Dadurch kommt es zu einem Volumenmangel im Herzkreislaufsystem und in der Folge zu einem plötzlichen Blutdruckabfall, der möglicherweise in einem lebensbedrohlichen Schock mit Herzkreislauf- und Atemstillstand enden kann.
Wie stellt der Arzt die Diagnose anaphylaktischer Schock?
Der Arzt stellt die Diagnose in der Regel aufgrund der beobachteten Symptome. Gegebenenfalls erhält er weitere Hinweise durch ein kurzes Gespräch mit der betroffenen Person oder deren Angehörigen, die eventuell Informationen über bekannte Allergien oder kürzlich stattgefundene Ereignisse geben können, die zum anaphylaktischen Schock geführt haben. So sind beispielsweise eventuelle Insektenstiche, neue Medikamente oder kürzlich verzehrte Speisen von Interesse. Da ein Mensch im anaphylaktischen Schock in Lebensgefahr schwebt, muss so schnell wie möglich gehandelt werden. Deshalb beschränken sich weitere Untersuchungen meist auf basale Eckpunkte wie Atmung und Herzkreislaufsystem.
Nach einer ersten Behandlung wird gegebenenfalls noch eine Blutuntersuchung durchgeführt, um einzelne Immunmediatoren wie die Serumtryptase (Aktivität der Mastzellen) zu bestimmen.
Wie behandelt der Arzt einen anaphylaktischen Schock?
Die Behandlung des anaphylaktischen Schocks richtet sich nach der Schwere und den jeweiligen Symptomen.
- Bei Herzkreislaufversagen wird versucht, die betroffene Person zu reanimieren. Außerdem wird ein Venenkatheter gelegt oder – falls das nicht möglich ist – ein Zugang zum Knochenmark geschaffen (intraossärer Zugang). Daraufhin verabreicht der Arzt Adrenalin über die Vene oder ins gut durchblutete Knochenmark. Es folgen gegebenenfalls eine Sicherung der Atemwege durch einen Schlauch (Tubus) und Flüssigkeitsinfusionen über die Vene.
- Bei Atem- und Kreislaufbeschwerden wird zuerst Adrenalin in den Muskel gespritzt und Sauerstoff zur Unterstützung der Atmung angeboten. Daraufhin wird auch hier versucht, einen Zugang zu Vene oder Knochenmark zu schaffen und Flüssigkeit zu verabreichen. Zusätzlich kommen gegebenenfalls weitere Medikamente wie Antihistaminika oder Glukokortikoide zum Einsatz.
- Sind die oberen Atemwege durch Schwellungen und Ödeme verlegt (verschlossen), verabreicht der Arzt ebenfalls Adrenalin in den Muskel oder zum Inhalieren. Auch hier wird in der Regel ein venöser Zugang geschaffen und gegebenenfalls Antihistaminika oder Glukokortikoide Sind die unteren Atemwege betroffen, kommen unter Umständen zusätzlich Beta-2-Sympathomimetika wie Salbutamol zum Einsatz, welche die Bronchien erweitern und das Atmen erleichtern.
- Ist der Verdauungstrakt beteiligt, kommen abhängig von den Symptomen in der Regel symptomatisch wirksame Medikamente zur Anwendung, beispielsweise um Bauchkrämpfe und Brechreiz zu stillen. Auch hier werden Antihistaminika und Glukokortikoide eingesetzt, um die allergische Reaktion zu stoppen beziehungsweise zu unterdrücken.
- Wenn lediglich die Haut betroffen ist, behandeln Ärzte ebenfalls symptomatisch mithilfe von Antihistaminika und Glukokortikoiden.
Bei allen Verläufen, die über deine bloße Hautreaktion hinausgehen, wird Patienten empfohlen, für eine Überwachung einige Zeit im Krankenhaus zu bleiben. Gegebenenfalls ist auch eine intensivmedizinische Betreuung notwendig.
Was können Sie selbst bei einem anaphylaktischen Schock tun?
Wenn es Anzeichen einer starken allergischen Reaktion gibt, gilt es zunächst,
- den Notruf zu verständigen.
- den Kontakt mit dem auslösenden Allergen möglichst zu unterbinden. So sollte beispielsweise ein Bienenstachel umgehend entfernt werden. Allerdings ist es wichtig dabei darauf zu achten, ihn nicht zu quetschen, weil sich an ihm ein Säckchen mit Gift befindet, das sonst zusätzlich in den Körper gelangen kann.
- die betroffene Person und Umstehende zu beruhigen.
- den Menschen mit anaphylaktischem Schock richtig zu lagern. In der Regel empfiehlt sich eine flache Lagerung. Bewusstlose sollten in stabiler Seitenlage gelagert werden, bei Kreislaufproblemen gegebenenfalls die Beine hoch lagern. Kommt es zur Atemnot, ist eine sitzende oder halbsitzende Position zu empfehlen.
Bevor es zu einem anaphylaktischen Schock kommt, ist es hilfreich,
- die genaue Ursache einer Allergie bei einem Allergologen abklären zu lassen, um das auslösende Allergen nach Möglichkeit meiden zu können,
- eine Anaphylaxie-Schulung in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls auch das Umfeld zu informieren, was im Notfall zu tun ist,
- wenn die allergischen Reaktionen schwerwiegender werden oder sehr stark sind und/oder sich das Allergen nicht sicher meiden lässt, ein Anaphylaxie-Notfallset Dieses beinhaltet einen Adrenalin-Autoinjektor, mit dem sich betroffene Personen im Notfall selbst Adrenalin spritzen können und meist ein Antihistaminikum, ein Glukokortikoid und eventuell auch ein Spray, das nach Inhalation die Bronchien erweitert.
- einen Allergiepass erstellen zu lassen, der immer bei sich getragen wird und in dem die bekannten Allergene aufgelistet sind.
Veröffentlicht am: 08.04.2025
____________________________________________________________________________________________________________________________
ICD Code(s)
ICD Codes sind Internationale statistische Klassifikationen der Krankheiten zu finden z.B. auf Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (AU) oder Ärztebriefen.
- Quelle: DIMDI
____________________________________________________________________________________________________________________________
Das könnte Sie auch interessieren
Quellen
[1]: Deutsche Gesellschaft für Allergologie und klinische Immunologie (DGAKI) et al. Leitlinie zu Akuttherapie und Management der Anaphylaxie – Update 2021, in: Allergo J Int. 2021; 30: 1-25, https://register.awmf.org/assets/guidelines/061-025l_S2k_Akuttherapie-Management-Anaphylaxie_2021-10.pdf
[2]: Amboss. Anaphylaxie und anaphylaktoide Reaktionen, https://www.amboss.com/de/wissen/Anaphylaxie_und_anaphylaktoide_Reaktionen/
[3]: Pschyrembel. Anaphylaktischer Schock, https://www.pschyrembel.de/Anaphylaktischer%20Schock/K0KHM
[4]: Pschyrembel. Immunglobulin E (IgE), https://www.pschyrembel.de/Immunglobulin%20E/K0AJA,
[5]: Renz, H., Gierten, B. (2019). Komplement-Spaltprodukte, in: Gressner, AM et Arndt, T. (Hrsg.) Lexikon der Medizinischen Laboratoriumsdiagnostik. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg.
Unsere Qualitätssicherung

„Viele Menschen nehmen dauerhaft eine Vielzahl von Arzneimitteln ein. Dieses kann mit möglichen Problemen und Risiken einhergehen. Ein sicherer Umgang mit Arzneimitteln und die Aufdeckung von Problemen während der Arzneimitteltherapie sind mir daher besonders wichtig."
Die österreichisch approbierte Apothekerin Julia Schink ist im Bereich Patient Care bei Shop Apotheke für die Betreuung von Polymedikationspatienten tätig. Die Ratgeber-Texte von Shop Apotheke sieht sie als tolle Möglichkeit um die Arzneimitteltherapiesicherheit unserer Kunden zu steigern.