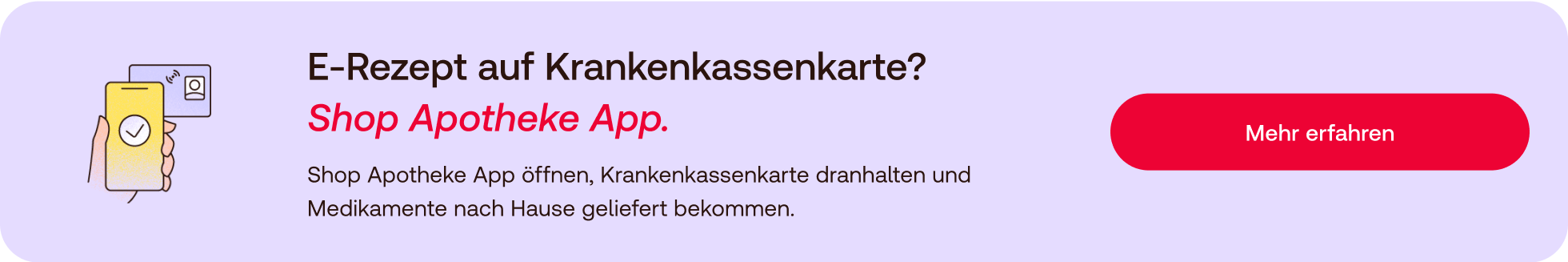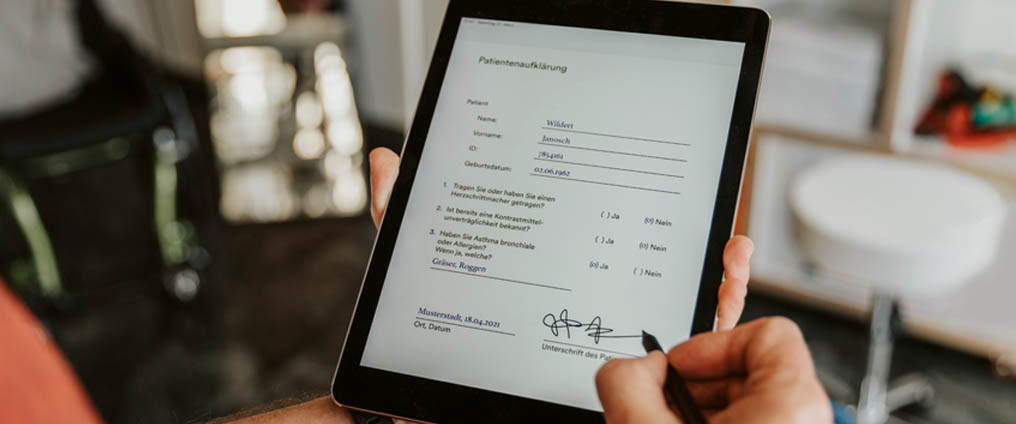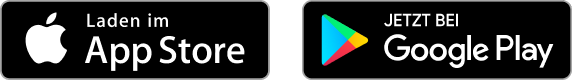Was kann die elektronische Gesundheitskarte?

Schnelleinstieg in unsere Themen
Zusammenfassung
Die elektronische Gesundheitskarte hat die Krankenversichertenkarte abgelöst und ist seit 2015 der einzige noch gültige Nachweis, der Versicherte zu Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung berechtigt. Zwar dient die Karte unter anderem der Speicherung der Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Adresse und Versichertenstatus, sie kann jedoch darüber hinaus noch vieles mehr und soll dazu beitragen, die medizinische Versorgung der Versicherten zu verbessern.
eGK: Stammdaten sind Pflicht
Die verschiedenen Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) werden seit 2020 schrittweise eingeführt. Bereits in Betrieb ist das Versichertenstammdatenmanagement (VSDM), das – im Gegensatz zu vielen anderen Funktionen der eGK – für jeden Versicherten verpflichtend ist. Sein Zweck ist es, die persönlichen Stammdaten – also beispielsweise Vor- und Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anschrift und Versichertenstatus – aktuell zu halten. Ärztliche Praxen sind deshalb dazu verpflichtet, die auf dem Chip der Versichertenkarte hinterlegten Stammdaten beim jeweils ersten Besuch der ärztlichen Praxis innerhalb eines Quartals auszulesen, zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Außerdem lässt sich der Karte entnehmen, ob für die Patientin oder den Patienten ein gültiges Versicherungsverhältnis besteht. Auch ein Foto auf der eGK ist für die allermeisten Versicherten Pflicht, um einen Missbrauch der Karte zu verhindern. Ausnahmen sind nur in einzelnen Fällen möglich, zum Beispiel bei Menschen, die aufgrund schwerer Pflegebedürftigkeit kein Foto übermitteln können sowie für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre.
Notfalldatenmanagement
Andere Anwendungen der eGK sind für die Versicherten freiwillig. Hierzu zählt zum Beispiel das seit Mitte 2020 verfügbare Notfalldatenmanagement (NFDM), in dem alle in einem Notfall relevanten medizinischen Daten hinterlegt sind. So enthält das NFDM Informationen zu Allergien und Vorerkankungen, verordneten Arzneimitteln oder einer bestehenden Schwangerschaft. Auch Hinweise zum Organspendeausweis, Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht können hier hinterlegt werden. Den Notfalldatensatz dürfen nur Ärzte und Ärztinnen anlegen, die umfassend über den Gesundheitszustand des Versicherten informiert sind, und zwar ausschließlich mit dessen ausdrücklicher Einwilligung. Zugriff haben im Falle eines medizinischen Notfalls alle Menschen, die einen elektronischen Heilberufsausweis besitzen, unter anderem die Notfallrettungskräfte. Bei einem normalen Arztbesuch darf die Praxis die Notfalldaten hingegen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der erkrankten Person einsehen.
Eine Weiterentwicklung soll ab Oktober 2024 erfolgen und die Notfalldaten zusammen mit den Hinweisen zu persönlichen Erklärungen in einer elektronischen Patientenkurzakte (ePKA) zusammenfassen. Patientinnen und Patienten sollen darauf selbstständig über ihr Smartphone, Tablet usw. zugreifen können.
Der elektronische Medikationsplan
Anstelle des bisher üblichen, auf Papier gedruckten Medikationsplans ist der bundeseinheitliche elektronische Medikationsplan (eMP) auf der eGK hinterlegt. Er steht allen Personen zu, die über einen Zeitraum von mindestens 28 Tagen drei oder mehr Medikamente einnehmen müssen, also besonders Menschen höheren Alters und chronisch erkrankten Menschen. Der eMP enthält Informationen zu allen ärztlich verordneten, aber auch selbst gekauften Medikamenten, und ihrer Dosierung sowie andere wichtige Informationen wie Angaben zu Allergien und Unverträglichkeiten. Besteht seitens der versicherten Person Anspruch auf einen eMP, sind haus- und fachärztliche Praxen dazu verpflichtet, diesen auf Wunsch des Patienten auf der eGK anzulegen und bei Bedarf zu aktualisieren. Letzteres gilt auch für Apotheken.
Die elektronische Patientenakte
Anspruch auf die elektronische Patientenakte (ePA) haben gesetzlich Krankenversicherte seit Mitte 2021. In ihr sollen alle medizinischen Daten eines Patienten zusammengeführt werden, unabhängig davon, in welcher Praxis oder in welchem Krankenhaus sie ursprünglich erhoben wurden. Nicht nur den erkrankten Personen, sondern auch dem behandelnden ärztlichen Personal, therapeutischen Einrichtungen und Apotheken stehen so alle relevanten Informationen auf einen Blick zur Verfügung. Welche Dokumente in der ePA hinterlegt werden, entscheidet dabei jedoch einzig und allein der Patient bzw. die Patientin. Außerdem dürfen ärztliche Praxen, Krankenhäuser, Therapeutinnen und Therapeuten und Apotheken nur mit ausdrücklicher Genehmigung der versicherten Person auf die hinterlegten Daten zugreifen. Versicherte verwalten ihre ePA normalerweise über eine durch die Krankenkasse zur Verfügung gestellte App. Über sie kann der Versicherte Dokumente hinzuzufügen, diese einsehen, wieder löschen oder mit individuellen Berechtigungen versehen. Die Krankenkassen stellen zwar die App (bzw. eine Desktop-Version) zur Verfügung, haben aber selbst keinen Zugriff auf die ePA.
Einlösung des E-Rezepts mit der eKG
Das E-Rezept nutzt neben weiteren Möglichkeiten auch die eGK als Einlöseweg. Dieses funktioniert über die CardLink Funktion. Die ärztliche Praxis speichert das E-Rezept, also die elektronische Verschreibung von Medikamenten, in der Telematikinfrastruktur ab. Mit der eGK kann das Rezept abgerufen werden und in der Wunschapotheke vor Ort oder online eingelöst werden, die die Medikamente dann bereitstellt oder liefert. Die Daten sind über diesen Weg verschlüsselt und vor dem Zugriff Dritter geschützt.
Elektronische Gesundheitskarte und Datensicherheit
Die eGK hält also zahlreiche nützliche Angebote für die Versicherten bereit, allerdings sind die Daten, die in Notfallmanagement, Patientenakte oder Medikationsplan hinterlegt sind, sehr sensibel und sollten keinesfalls in fremde Hände geraten. Manch einer stellt sich deshalb vermutlich die Frage, wie es um die Datensicherheit der eGK bestellt ist.
Der Datenaustausch innerhalb des Gesundheitswesens erfolgt über ein eigens hierfür geschaffenes, sicheres Netzwerk, die Telematikinfrastruktur. Die Verantwortung für die Einführung und den Betrieb der Telematikinfrastruktur liegt bei der gematik. Den Datenschutz und die Sicherheit aller technischen Komponenten (zum Beispiel dem Kartenlesegerät) zu gewährleisten, ist eine ihrer Kernaufgaben, die sogar gesetzlich verankert ist. Auch alle Dienstleistungen wie zum Beispiel Apps müssen zunächst von der gematik zugelassen werden. Der Schutz der sensiblen Gesundheitsdaten ist durch moderne kryptographische Verfahren sichergestellt, die laufend an den aktuellen Stand der technischen Forschung angepasst und weiterentwickelt werden.
Die Telematikinfrastruktur stellt auch sicher, dass nur berechtigte Leistungserbringer im Gesundheitswesen auf die hinterlegten Daten zugreifen können, und das ausschließlich mit der ausdrücklichen Einwilligung der versicherten Person. Der Zugriff erfolgt nach dem sogenannten „Zwei-Schlüssel-Prinzip“: Sowohl die eGK des Patienten als auch der Heilberufsausweis des ärztlichen Behandelnden müssen in das Kartenlesegerät eingeführt werden und beide, die versicherte Person und die medizinische Fachkraft, müssen zusätzlich eine persönliche PIN eingeben. Nur für den Zugriff auf die Notfalldaten ist keine PIN erforderlich.
Fazit
Die elektronische Gesundheitskarte enthält nicht nur die Stammdaten einer gesetzlich versicherten Person, sondern kann Informationen über Medikamente, Vorerkrankungen und mögliche Verfügungen, beispielsweise zur Organspende, bereitstellen. Wenn es schnell gehen muss, etwa bei einem Notfall, sind die notwendigen Daten schnell verfügbar – allerdings können nur medizinische Fachkräfte mit Heilberufsausweis darauf zugreifen. Andere Gesundheitseinrichtungen wie Apotheken sehen die Informationen nur mit ausdrücklicher Zustimmung der versicherten Person ein. In Zukunft soll die eKG noch weiterentwickelt werden, sodass Patientinnen und Patienten selbständig per Tablet oder Smartphone auf ihre Akte zugreifen können.
Veröffentlicht am: 25.08.2023
Letzte Aktualisierung: 07.08.2024
Das könnte Sie auch interessieren
Quellen
[1] Bundesministerium für Gesundheit. Elektronische Gesundheitskarte (eGK). https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/egk.html
[2] Bundesministerium für Gesundheit. E-Rezept. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/e-rezept
[3] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Elektronische Gesundheitskarte (eGK). https://www.kbv.de/html/egk.php
[4] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Versichertenstammdatenmanagement (VSDM). https://www.kbv.de/html/vsdm.php
[5] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Notfalldatenmanagement (NFDM). https://www.kbv.de/html/nfdm.php
[6] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Elektronischer Medikationsplan (eMP). https://www.kbv.de/html/emp.php
[7] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Elektronische Patientenakte (ePA). https://www.kbv.de/html/epa.php
[8] Verband der Ersatzkassen. Elektronische Gesundheitskarte (eGK). https://www.vdek.com/presse/glossar_gesundheitswesen/elektronische_gesundheitskarte.html
[9] gematik. https://www.gematik.de/anwendungen/e-rezept/versicherte